Für hunderttausende Menschen im Rhein-Main-Gebiet beginnt der Tag mit einem Blick auf die Fahrplan-App und der Hoffnung auf einen reibungslosen Weg zur Arbeit, Universität oder Schule. Doch die Realität im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Frankfurts stellt diese Hoffnung oft auf eine harte Probe. Massive Verspätungen, kurzfristige Ausfälle und überfüllte Fahrzeuge sind keine Seltenheit, sondern scheinen sich für viele zur zermürbenden Routine zu entwickeln. Der ÖPNV, einst von Visionären als Rückgrat der urbanen Mobilität und Schlüssel zur Verkehrswende gepriesen, entwickelt sich zur täglichen Geduldsprobe.
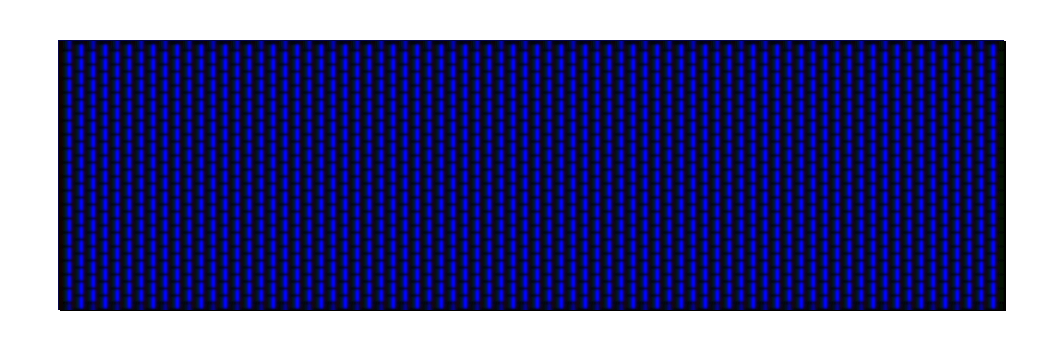
Das Szenario ist vielen Pendlern wohl schmerzlich vertraut: Dichtes Gedränge auf den Bahnsteigen der S- und U-Bahnen bereits am frühen Morgen. Digitale Anzeigen versprechen eine pünktliche Abfahrt, doch die Bahn lässt auf sich warten. Minuten später dann die Information – wenn sie denn kommt: Technische Störung, Signalprobleme, Weichenstörung oder Personalmangel. Oftmals verschwindet die angekündigte Fahrt kommentarlos von der Anzeige. Was folgt, ist eine Kettenreaktion: Anschlussverbindungen werden verpasst, alternative Routen sind überlastet und die verbleibenden Züge &/ Busse quellen über vor Fahrgästen.
Die Konsequenzen für den Einzelnen scheinen gravierend werden zu können: Stress noch vor Arbeitsbeginn, verspätete Ankünfte bei Terminen, Probleme bei der Kinderbetreuung, im schlimmsten Fall könnten berufliche Sanktionen drohen. Die Planbarkeit des Alltags, essenziell für Berufstätige und Familien, löst sich folglich auf. Die in Echtzeit-Apps versprochene Transparenz kollidiert dabei häufig mit der Realität an Gleis und Haltestelle, was die Frustration zusätzlich steigert.
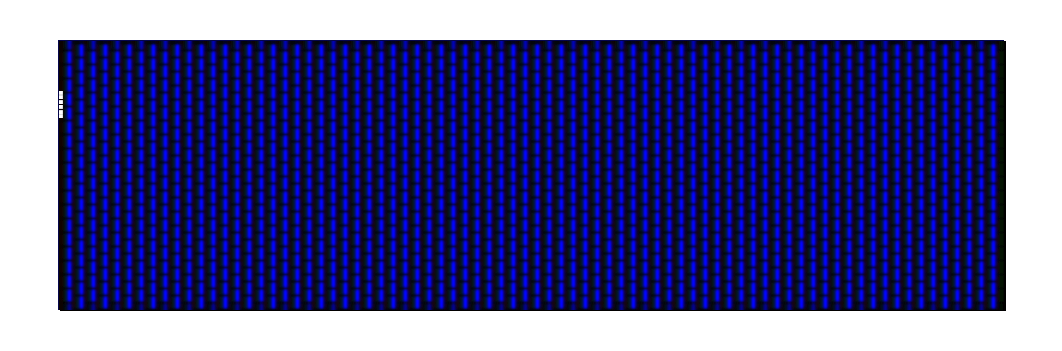
Zur Nachvollziehbarkeit: Die wahrnehmbare andauernde Unzuverlässigkeit des öffentlichen Nahverkehrs in Frankfurt lässt sich auf eine Vielzahl struktureller Faktoren zurückführen. Ein über Jahrzehnte entstandener Investitionsstau in der Infrastruktur – einschließlich veralteter Schienennetze, Stellwerke und sanierungsbedürftiger Tunnel – trifft auf ein System, das nahe an seiner Kapazitätsgrenzen operiert. Die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen sowie zahlreiche Baustellen führen folglich zu unvermeidbaren Einschränkungen, die teilweise unzureichend kommuniziert werden.
Beispiel Regionaltangente West: Ein Jahrzehnte dauerndes Infrastrukturprojekt
Bereits 2005 fiel die Entscheidung für die Regionaltangente West (RTW). Am 15. Dezember 2024 verabschiedete die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung den Gesamtverkehrsplan 2000 und beauftragte den Magistrat mit der Planung des tangentialen Schienenverkehrsprojekts. Die Zielsetzung: Neue Verbindungen zwischen Städten außerhalb Frankfurts schaffen, um die Innenstadt zu entlasten und Reisezeiten zu verkürzen. Doch von der ersten politischen Entscheidung bis zum Baubeginn vergingen fast zwei Jahrzehnte.
Die Planungsphase zog sich aufgrund zahlreicher Verzögerungen in die Länge. 2008 wurde die RTW-Planungsgesellschaft gegründet, mit dem Ziel, binnen drei Jahren die Voraussetzungen für den Bau zu schaffen – eine Frist, die nicht eingehalten werden konnte. Zwischen 2009 und 2012 verzögerten sich Ausschreibungen und Finanzierungszusagen. Erschwerend kamen Unsicherheiten hinsichtlich der Gesamtkosten von rund 500 Millionen Euro sowie gesetzliche Förderregeln hinzu, die 2019 ausliefen.
Zusätzlich beeinträchtigten lokale Widerstände und Diskussionen den Fortschritt. 2013 trat die Stadt Friedrichsdorf der Planungsgesellschaft bei und die Stadt Eschborn gab ihren Widerstand 2019 auf. Parallel wurden immer neue Varianten wie eine Regionaltangente Ost oder ein vollständiger Schienenring um Frankfurt diskutiert, was die Umsetzung weiter verzögerte.
2015 schloss die EU eine Finanzierungslücke mit Fördermitteln in Höhe von 7,6 Millionen Euro. Im Mai 2022 begann schließlich die Bauphase mit arbeiten am Bahnhof Frankfurt Stadion. Die RTW, die sowohl neue Strecken als auch bestehende Abschnitte nutzen soll, ist zur Teilinbetriebnahme für 2026 und zur vollständigen Fertigstellung für 2029 geplant.
Mit der RTW wird eine dringend benötigte Entlastung des Frankfurter Hauptbahnhofs und City-Tunnels angestrebt. Die langwierige Planungsphase zeigt, wie schwierig es ist, komplexe Infrastrukturprojekte im Regionalraum effizient voranzutreiben.
Neben diesem Beispiel gibt es auch weitere, wie etwa die RB 11 von Ffm. Höchst nach Bad Soden oder der Offenbacher-City-Tunnel.
Stichwort Fahrzeugflotte:
Doch die Probleme gehen über die reine Infrastruktur hinaus. Ein zentraler Aspekt, der die Situation in jüngster Zeit zusätzlich verschärft, betrifft die dringend notwendige Erneuerung und Erweiterung der Fahrzeugflotte. Zwar werden neue Fahrzeuge bestellt, um überaltertes Material zu ersetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, doch diese Bereiche scheinen selbst zu einer Quelle erheblicher Probleme geworden zu sein:
Lieferverzögerungen: Hersteller von Schienenfahrzeugen kämpfen europaweit mit Lieferkettenproblemen, Materialengpässen und Produktionsverzögerungen. Dies führt dazu, dass dringend erwartete neue Züge für U-Bahn und Straßenbahn oft erst mit Verspätung in Frankfurt eintreffen. Geplante Kapazitätserweiterungen oder der Ersatz störanfälliger Altfahrzeuge verzögern sich dadurch maßgeblich, was das angespannte System weiter belastet.
„Kinderkrankheiten“ bei neuen Fahrzeugen: Selbst, wenn die neuen Bahnen endlich auf den Gleisen stehen, folgt oft die nächste Phase der Ernüchterung. Die sogenannten „Kinderkrankheiten“ neuer Fahrzeuggenerationen sorgen für zusätzliche Unzuverlässigkeit und Frustration.
Beispiel 1:
Straßenbahn Typ „T“:
Die Einführung der neuesten Frankfurter Straßenbahn-Generation (Typ „T“) war und ist von wiederkehrenden technischen Problemen begleitet. Schwierigkeiten mit der komplexen Software, der Türsteuerung oder die unterdimensionierte Klimaanlage und viel zu kleine Behälter für den Bremssand führten dazu, dass die modernen Züge zeitweise nur eingeschränkt oder gar nicht einsatzfähig waren und immer wieder kurzfristig aus dem Betrieb genommen werden mussten. Im November 2024 wurden Sie dann komplett aus dem Betrieb genommen und bisher (Stand: April 2025) auch nicht wiedergesehen.
Beispiel 2:
Wasserstoffzüge im Taunusnetz:
Auch, wenn es sich um ein Projekt des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) handelt, betrifft es tausende Pendler auf dem Weg nach Frankfurt: Die Einführung der als zukunftsweisend geltenden Wasserstoffzüge im Taunusnetz (betrieben von Alstom) entwickelte sich zu einem operativen Desaster. Massive technische Unzuverlässigkeit, häufige Totalausfälle, Probleme bei der Betankung und eine zu geringe Kapazität führten monatelang zu chaotischen Zuständen, erforderten den Einsatz von Bussen oder alten Dieselzügen und zerrütteten das Vertrauen der Fahrgäste nachhaltig.
Diese Schwierigkeiten bei der Flottenerneuerung – von verspäteten Lieferungen bis hin zu technischen Mängeln bei fabrikneuen Zügen – überlagern und verschärfen folglich die ohnehin schon spürbaren Probleme durch den Investitionsstau bei der Infrastruktur und die hohe Netzauslastung. Sie zeigen, dass selbst hohe Investitionen in die Beschaffung keine Garantie für sofortige Besserung ist.
Personalmangel:
Gleichzeitig kämpfen die Verkehrsunternehmen mit akutem Personalmangel, besonders durch hohe Krankenstände und Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fahrpersonal und Technikern. Diese Problematik wirkt sich negativ auf die Attraktivität der Arbeitsbedingungen aus und erschwert die Gewinnung neuer Mitarbeiter*innen. Die daraus resultierenden Engpässe führen zu Fahrtausfällen und einem ausgedünnten Angebot, das sich seit Januar 2024 in einem angepassten Fahrplan widerspiegelt, der etwa drei Prozent unter dem Angebot von 2023 liegt. Ursprünglich als vorübergehende Maßnahme für sechs Monate gedacht, wurde dieser Fahrplan aufgrund anhaltender personeller Defizite mehrfach verlängert (ausgenommen sind hierbei externe Einflüsse wie Notarzteinsätze oder polizeiliche Eingriffe).
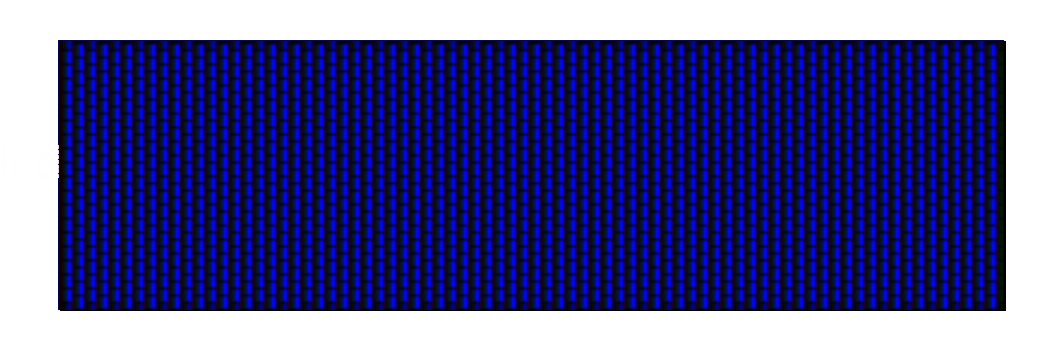
Politik und Stadtgesellschaft propagieren die Verkehrswende – weg vom Individualverkehr, hin zu einem starken, umweltfreundlichen ÖPNV. Doch das aktuelle Bild scheint dieses Ziel zu konterkarieren. Wer auf den ÖPNV umsteigen will oder muss, erlebt ihn oft nicht als attraktive, sondern als unzuverlässige und stressige Alternative. Die Glaubwürdigkeit der Bemühungen leidet, wenn das Rückgrat der angestrebten Mobilitätswende selbst unter seiner Last ächzt. Die tägliche Geduldsprobe auf den Bahnsteigen ist keine Werbung für den Umstieg.
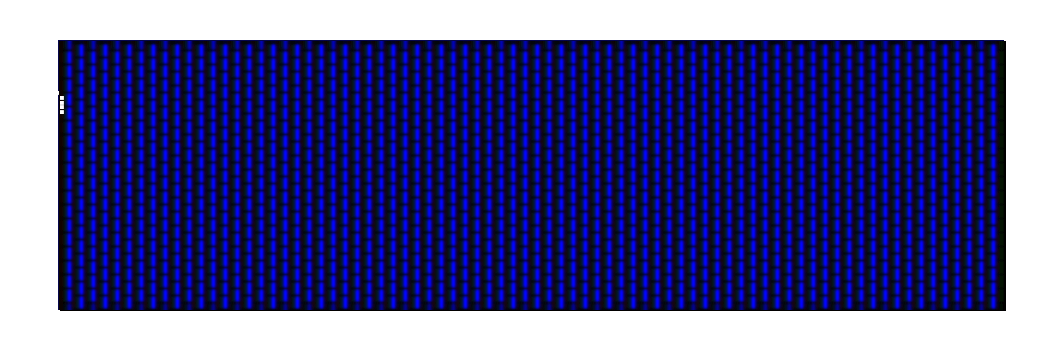
Welche möglichen Handlungsbedarfe angesichts der genannten Einzelfälle im Frankfurter ÖPNV, könnten für darauf angewiesene Pendler*innen eine Rolle spielen, das System verlässlicher und sicherer zu gestalten?
In folgenden Bereichen sind mögliche Handlungsbedarfe zusammengefasst:
- Nachhaltige Finanzierung und beschleunigter Ausbau: Der Investitionsstau sollte konsequent abgebaut, die Infrastruktur modernisiert und die Kapazität des Netzes erhöht werden.
- Verbessertes Personalmanagement: Arbeitsbedingungen sollten attraktiver gestaltet, die Ausbildung forciert und Personalengpässe aktiv bekämpft werden.
- Transparente und proaktive Kommunikation: Fahrgäste benötigen zeitnahe, verlässliche Informationen über Störungen und Alternativen – über alle möglichen Kanäle hinweg.
- Effizienteres Baustellenmanagement: Unvermeidbare Baustellen sollten besser koordiniert und kommuniziert werden, um die Auswirkungen zu minimieren.
Für Pendlerinnen und Pendler in Frankfurt ist ein deutlich verbessertes und verlässliches Nahverkehrssystem von großer Bedeutung. Andernfalls droht die tägliche Fahrt zur Arbeit dauerhaft zur Zerreißprobe für die Nerven und zu einer ernsthaften Belastung für den Wirtschafts- und Lebensstandort Frankfurt zu werden.
Text: N. Tangermann, rek, MJP
Gestaltung: Jku
Bilder: DaN / Jku




